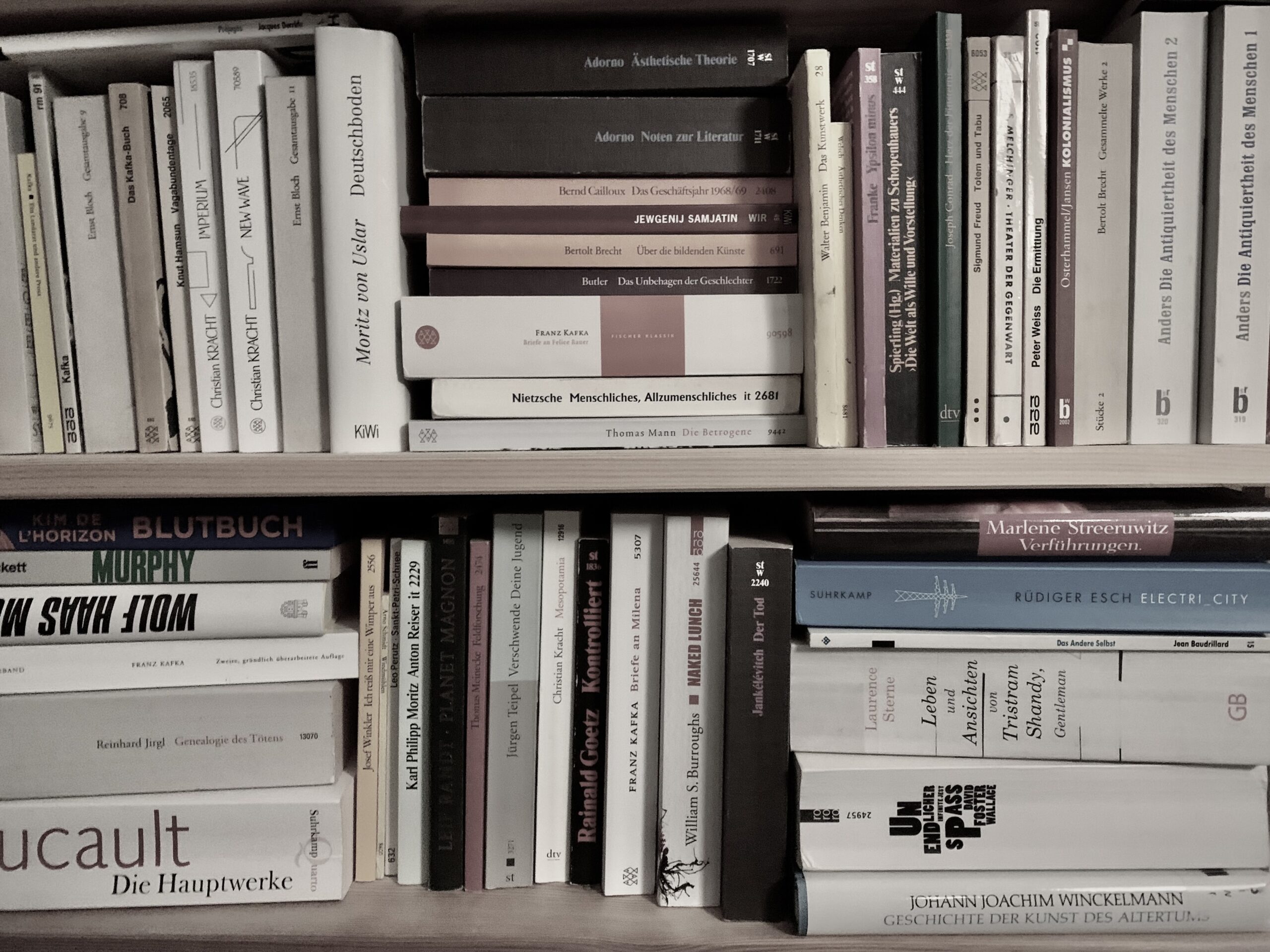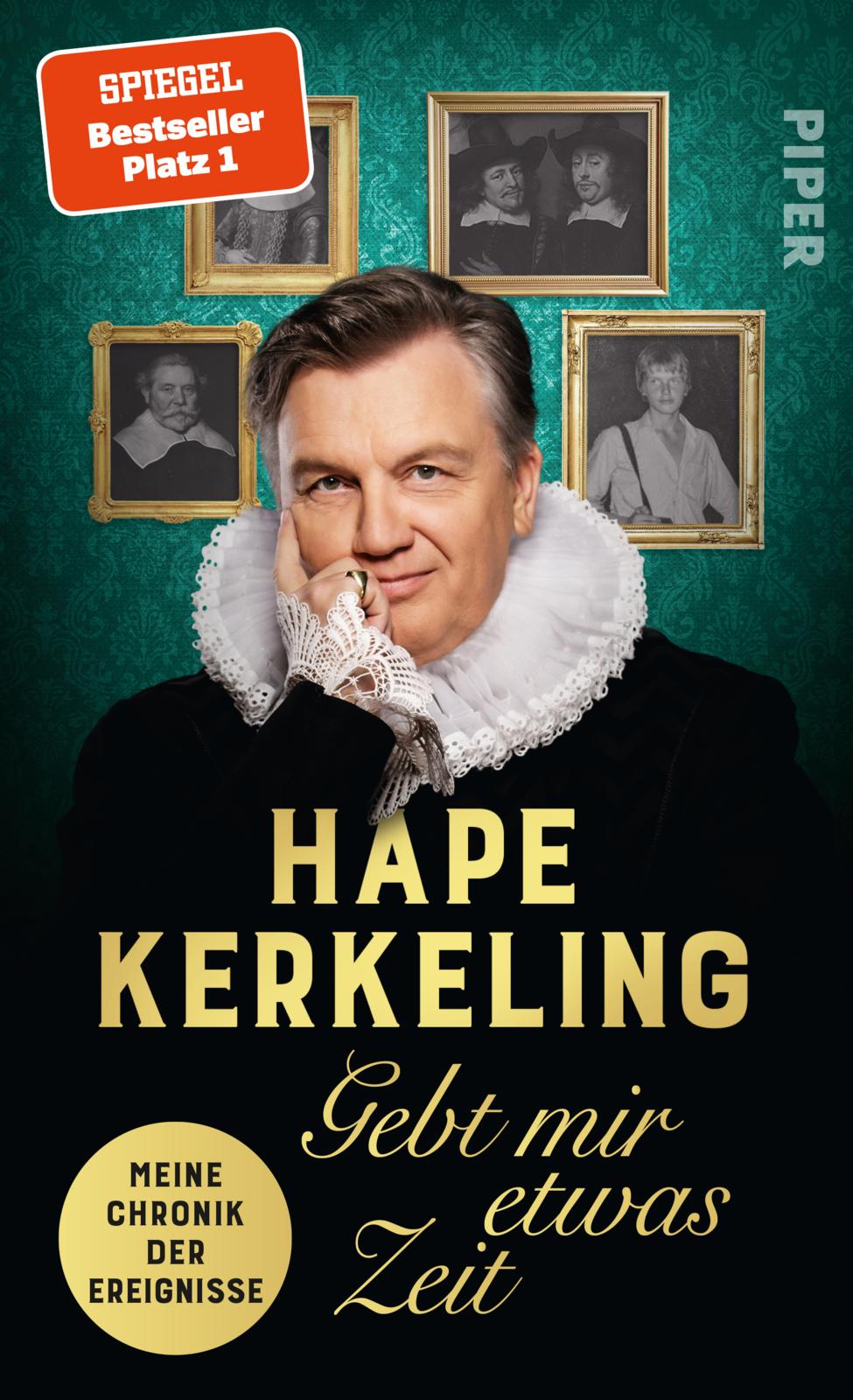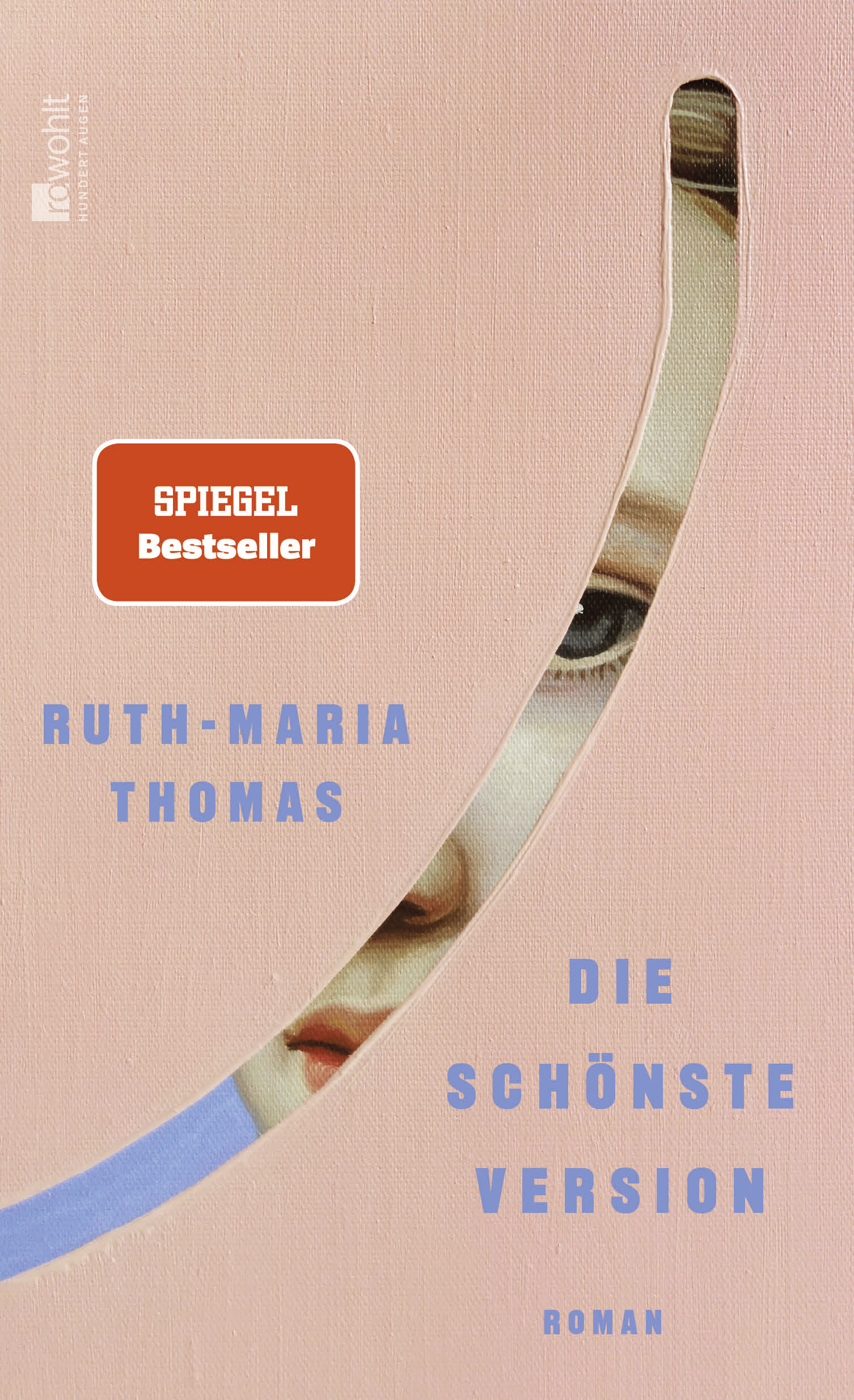von Hugo Siebold
Hape Kerkeling hat mich oft zum Lachen gebracht, doch sein neuestes Buch zeigt ihn von einer ernsteren Seite. In Gebt mir etwas Zeit (2024, Piper Verlag) begibt er sich auf eine persönliche Spurensuche – mal fesselnd, mal weniger packend.
Kerkeling verbindet Erlebnisse aus seinem Leben mit der Geschichte seiner Vorfahren, wobei die Ahnengeschichte der „Kerckrings“ in Amsterdam einen großen Teil einnimmt. Die historischen Rückblicke vermischen sich mit seinen persönlichen Erlebnissen, vom Aufstieg im Showbusiness bis zu den bewegenden Momenten seiner Beziehung zu Duncan und dessen Aids-Diagnose.
Zwischen Humor und Melancholie
Im Gegensatz zu vielen klassischen Biografien wählt Kerkeling einen erfrischend anderen Ansatz. Er verzichtet auf eine herkömmliche, chronologische Erzählweise. Stattdessen erzählt er in einem lebensnahen Stil einzelne Geschichten aus seiner Vergangenheit. Diese Herangehensweise gleicht einer Stadtführung abseits der Touristenpfade, man taucht tiefer ein und versteht mehr. So lernt man den Autor nicht nur als Person kennen, sondern bekommt auch einen lebendigen Eindruck davon, wie er „tickt“. Gerade die persönlichen Geschichten hinterlassen einen bleibenden Eindruck und gerade auf diesen kommt es mir letztlich an.
Der Schreibstil macht einfach Spaß. Er ist lebendig und mitreißend. Man hat das Gefühl, als würde man direkt mit dem Autor reden. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund:
„Deswegen habe ich mich charaktertechnisch nicht für scheu, lieb oder neunmalklug entschieden, sondern für lustig. Und glauben Sie mir, das war gut so. Zugegeben, lustig gewinnt zwar fast nie, aber lustig landet auch nicht auf der Matte. (Der Satz ist so uneindeutig, der könnte glatt von der SPD sein.)“.
Ein persönliches Puzzle aus Vergangenheit und Gegenwart
Kerkeling lernt seine große Liebe Duncan im April 1987 in einem Club in Amsterdam kennen. Schon im ersten Moment funkt es zwischen den beiden. Ihre Liebesgeschichte nimmt einen großen Teil im Buch ein. Er beschreibt die schönen Momente genauso anschaulich wie die schwierigen, etwa als Duncan seine Aids-Diagnose erhält.
Kerkeling schafft es, dass man als Leser:in Mitgefühl und kein Mitleid entwickelt.
„Nur wenige Wochen nach dem Befund zeigt Aids seine böse Fratze und beginnt, Duncans Körper gezielt zu zerstören. Die Zerstörungswut dieser Krankheit ist unvergleichlich und hat etwas Dämonisches. Jede Zelle des Körpers scheint betroffen zu sein.“
Bei so schwierigen Themen, eine große Fähigkeit!
Doch so bewegend diese Passagen sind, nicht jede Thematik im Buch hat mich gleichermaßen gepackt. Wer sich nicht für Ahnenforschung interessiert, wird sich mit den Passagen über die Vorfahren schwertun. Besonders die Erzählungen über die Kerckrings, eine wohlhabende Amsterdamer Familie des 17. Jahrhunderts, sind für mich eher nebensächlich.
Diese Passagen verdeutlichen seine besondere Verbindung zu den Niederlanden, doch ich wartete beim Lesen nur darauf, dass sie zu Ende gingen, um wieder in die spannenden Erlebnissen seines Lebens einzutauchen. Anderen wird diese Abwechslung aus Realität und Fiktion aber vielleicht gefallen.
Der Schreibstil und die Erzählkunst von Hape Kerkeling sind wirklich beeindruckend. Seine Fähigkeit, zu unterhalten, zeigt sich auch in diesem Buch. Und das nicht nur oberflächlich, sondern auch tiefgründig. Die Familiengeschichte, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht, konnte mich nicht fesseln. Mit einem stärkeren Fokus auf sein eigenes Leben hätte dieses Buch für mich das Potenzial gehabt, die beste Biografie zu werden, die ich je gelesen habe.